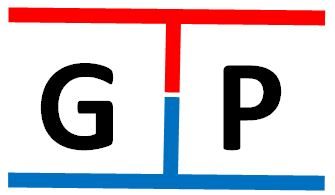Abklärung von Thrombosestörungen/-risiken („Thrombophilie“)
In den vergangenen Jahrzehnten sind bedeutende Fortschritte in der Thromboseforschung erzielt worden. Insbesondere haben die Möglichkeiten einer differenzierten hämostaseologischen Laboranalytik zu einem Rückgang thrombotischer/embolischer Komplikationen geführt. Hierzu haben auch die Möglichkeiten der Erkennung molekularbiologischer Zusammenhänge Wesentliches beigetragen. Thrombosen entstehen meist multifaktoriell. Doch kann eine angeborene, oder erworbene Thrombophilie klinische Bedeutung erlangen. Die Kenntnis einer Thrombophilie kann daher dazu beitragen, dass thrombotische Komplikationen verhindert, oder auch „Wiederholungsereignisse“ vermieden werden können. Obwohl eine venöse Thromboembolie häufig vermeidbar ist, gilt sie weltweit als dritthäufigste Todesursache.
Daher sind auch sogenannte „Familienuntersuchungen“ von (noch) asymptomatischen Personen/Familienmitgliedern von Bedeutung.
Die aus den diagnostischen Möglichkeiten ableitbaren Konzepte für Prophylaxe und Therapie leisten einen gewichtigen, sozialmedizinischen Beitrag. Ein kollegialer Dialog zwischen den Fachdisziplinen, niedergelassenen Kollegen und „Klinikern“ ist daher eine unabdingbare Voraussetzung auf dem Weg zur Bewältigung einer auch volkswirtschaftlich bedeutsamen Aufgabe, – der weitest möglichen Minimierung von Kosten durch Reduktion meist lebenslanger, schwerwiegender Folgeschäden, wie z.B. einem „postthrombotischen Syndrom“, oder auch Einschränkungen von Herz und Lunge, oder auch neurologischer Erkrankungen/Defizite und Schwangerschaftskomplikationen.
Im klinischen Alltag fehlt oft die Plausibilität für ein Krankheitsbild/stattgehabtes thrombotisches/embolisches Ereignis und/ oder von Rezidiv-Komplikationen (Häufung von „Ereignissen“).
Unsere größte „Waffe“ solchen Ereignissen wirksam begegnen zu können, ist eine messbare Risiko-Kalkulation. Zahlreiche angeborene, und erworbene hämostaseologische Störungen sind ursächlich mit einem erhöhten (venösen & arteriellen) Thromboserisiko verknüpft. Für diese Konstellation wurde der Begriff „Thrombophilie“ geschaffen.
Mittlerweile beträgt das Verhältnis der Patienten mit einer erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagischer Diathese) zu einer erhöhten Thromboseneigung („Thrombophilie“) ca. 1:4. Der Hämostaseologe ist daher heutzutage in weit stärkerem Maße gefordert mit Kardiologen, Angiologen, Neurologen, Gynäkologen, und Pädiatern zu kooperieren, als bei der Betreuung von Blutstillungs-Störungen.
Neben einer (oft unerkannten) angeborenen, oder erworbenen Neigung zu Thrombosekomplikationen „Thrombophilie“) fürchten wir als „Auslöser“ (sog. Triggermechanismen) chirurgische Eingriffe, akute Infekte (z.B. Corona-Infektionen), chronisch-entzündliche Erkrankungen, Tumorerkrankungen, aber auch die Immobilisation und medikamentöse Einflüsse (z.B. hormonelle Kontraceptiva/“Pille“) . Auf der arteriellen Seite sind Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Herzschwäche/-infarkt, und Stoffwechselerkrankungen zu nennen.
Ein gezieltes Thrombophilie-Screening ermöglicht einen rechtzeitigeren „Therapiebeginn“ bei früherer Diagnosestellung, aber auch die Minimierung langfristiger Folgeschäden. Andererseits kann die Kenntnis einer Thrombophilie im Stadium vor einem klinischen Ereignis, d.h. noch im präklinischen Stadium, einen Beitrag zur Verhütung/Prävention von Beinvenenthrombosen, Lungenembolien, Schlaganfall, oder einer Fehlgeburt/ Abort leisten.
Abklärung von Blutungsstörungen/risiken („Hämophilie“/hämorrhagische Diathesen):
Für Blutgerinnungsstörungen, die mit einem erhöhten Blutungsrisiko einhergehen, ergeben sich oftmals aus der Anamneseerhebung (Vorgeschichte der Patienten) wichtige Hinweise.
So schildern Patienten oftmals eine Neigung zu „blauen Flecken“/Hauteinblutungen/Blut-ergüssen, oder auch verstärkten Blutungen nach Operationen. Hinter einem „Nasenbluten“, oder auch einer verstärkten Periodenblutung kann sich auch eine (hereditäre, oder erworbene) Gerinnungsstörung verbergen. Aber auch medikamentöse Einflüsse können die Balance der Blutgerinnung empfindlich stören.
Bei einer umfassenden Gerinnungsanalytik können Patienten nicht selten mit einem sowohl erhöhtem Thrombose- wie auch erhöhtem Blutungsrisiko entdeckt werden, wobei letztlich die Symptomatik darüber Auskunft gibt, auf welche Seite der Blutgerinnung die „Waage kippt“ (auch im Falle eines „Kombinationsdefekts“).
Wichtig ist die Ursache geklärt zu wissen, um auch Blutungskomplikationen zukünftig vermeiden zu können.
Auch hierbei sind Familienuntersuchungen scheinbar asymptomatischer Familienmitglieder anzustreben; denn wer noch nie durch eine Verletzung, oder auch Operation blutungsgefährdet war, wird u.U. noch nicht auffällig geworden sein können, bzw. Symptome aufweisen. Das klassische Krankheitsbild der Hämophilie A/B, das sich durch ein verändertes Geschlechtschromosom (X-Chromosom) und unterschiedliche Schweregrade auszeichnet, gilt eher als Rarität. Dennoch sollte auch eine Gerinnungsfaktoren-Analyse Bestandteil einer neuzeitlichen Gerinnungsanalytik sein.
Perioperatives Management/Präventivmanagement:
Nach Kenntnis der Befunde, die mit einem erhöhten Thrombose- und/oder Blutungsrisiko einhergehen, erfolgt die Aufklärung der Patienten, über Maßnahmen, wie zukünftig bei z.B. operativen Eingriffen/Entbindungen Komplikationen vermieden, bzw. erneute Komplikationen verhindert werden können.
Ziel ist es sowohl (Rezidiv-)Thrombosen, wie auch Blutungskomplikationen zu vermeiden. Hierbei dürfen auch Medikamenten-Interaktionen nicht unberücksichtigt bleiben.